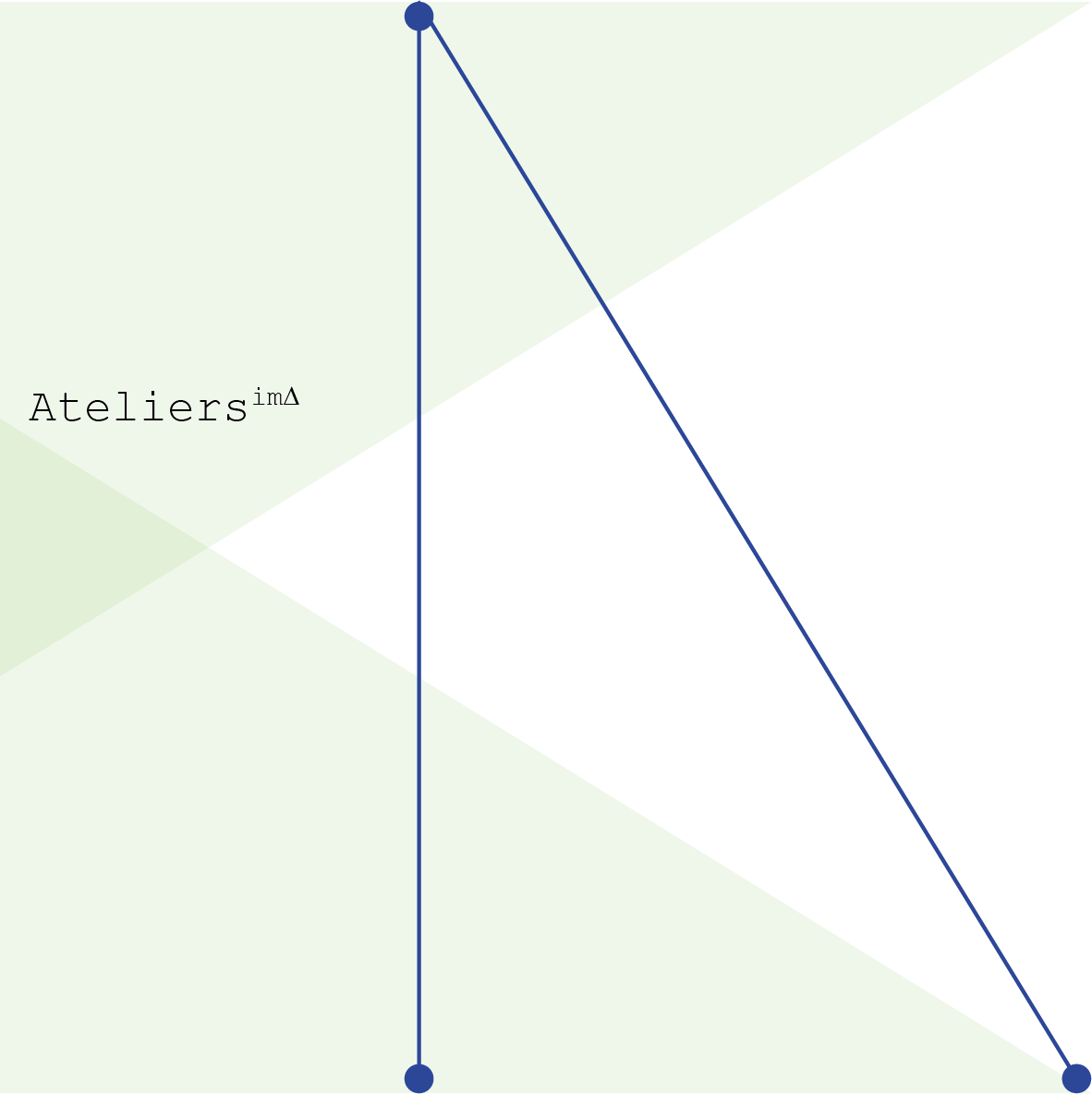Mein christliches Testament
– Eine christliche Erkenntnislehre des Heiligen
Das christliche Testament setzt sich über eine Erkenntnislehre des Heiligen mit den nach weiteren Reformen rufenden Teilen des christlichen Glaubens auseinander.
Bild aus: Ralf Moser | Mein christliches Testament | Und erlöse uns von dem Übel | 2015
„Wo Engel zögern: Unterwegs zu einer Epistemologie des Heiligen“ von Gregory und Mary Catherine Bateson ist ein Werk voller visionärer Gedanken und tiefgründiger Fragen. Es eröffnet Perspektiven, die weit über ein einzelnes Leben hinausreichen – ein Leben allein genügt nicht, um all die darin enthaltenen Einsichten und Rätsel vollständig zu erfassen.
Die Erkenntnislehre des Heiligen – Eine Reise jenseits der Grenzen des Wissens
Die Erkenntnislehre des Heiligen ist weit mehr als ein akademisches Unterfangen – sie ist eine Einladung zu einer tiefgründigen, offenen und ehrfürchtigen Auseinandersetzung mit dem, was jenseits unseres Lebens, unserer Erfahrung und unseres Wissens liegt. Inspiriert von den visionären Gedanken Gregory und Mary Catherine Batesons stellt sie die zentrale Frage: Was bedeutet das Heilige im Kontext von Erkenntnis, Wissenschaft und einer kybernetischen, am Lernen orientierten Modellbildung?
In einer Welt wachsender Komplexität wendet sich die Erkenntnislehre des Heiligen bewusst gegen vereinfachende und idealisierende Weltbilder. Sie folgt den Spuren des Heiligen – in alten Mythen, rituellen Handlungen, heiligen Schriften, in der Kunst und in der Tiefe menschlicher Erfahrung. Dabei wird „Lehre“ nicht nur als Vermittlung von Wissen verstanden, sondern als lebendige Praxis des Fragens, Verstehens, Verbindens – und des kreativen Erschließens neuer Möglichkeiten.
Diese Lehre wurzelt in einem Weltbild, in dem Glaube durch Beobachtung und Wissen begrenzt wird – und richtet sich zugleich gegen jede Form von Idealisierung, die das Geheimnisvolle, Magische und Nicht-Erklärbare einengt oder verdrängt. Die Ursprünge des Heiligen reichen tief: zu den Göttern und Geistern alter Religionen, zu magischen Praktiken, Opfergaben, heiligen Orten – und seit der Erfindung der Schrift auch zu den heiligen Texten, die nicht nur Wissen, sondern spirituelle Weisheit überliefern.
Die Erkenntnislehre des Heiligen ist ein offener Denkraum. Sie lädt dazu ein, Wissenschaft, Glaube und Spiritualität nicht als Gegensätze, sondern als Teile eines größeren Ganzen zu begreifen. Sie fragt:
Wie können wir das Heilige betrachten, ohne es zu entzaubern? Und wie können wir erkennen, ohne zu entheiligen?

Von Ahnen, Geistern, namenlosen Göttern und einem heiligen Berg
– Eine Erkenntnislehre des Heiligen
Ralf Moser | Eine Erkenntnislehre des Heiligen | Der Opfertisch der Heiden| 2022
Es geht um die großen Fragen des Menschseins: den Kreislauf des Lebens und die Idee der Unsterblichkeit. Diese Themen gewannen bereits in Jäger- und Sammlerkulturen an Bedeutung und erreichten in den frühen, sesshaften Ackerbaugesellschaften einen ersten Höhepunkt.
Ein entscheidender Wendepunkt war die Jungsteinzeit – die Zeit, in der der Ackerbau seinen Weg in die Welt fand. Sein Ursprung könnte mit einem besonderen Ort verbunden sein: dem ersten heiligen Hügel der Menschheit – Göbekli Tepe. Der Archäologe Klaus Schmidt (1953–2014) stellte die Hypothese auf, dass es sich dabei um ein steinzeitliches Bergheiligtum handelte. Er vermutete, dass sich hier erstmals verschiedene Jägergruppen zusammenschlossen, um gemeinsam eine rituelle Begegnungsstätte zu errichten.
Aus dieser Zusammenarbeit entstand mehr als nur ein heiliger Ort: Der Ackerbau und die Viehzucht entwickelten sich als direkte Folge. Die Jäger begannen, das wild wachsende Getreide am Berg gegen tierische und menschliche Konkurrenten zu verteidigen – ein entscheidender Schritt auf dem Weg zur Zivilisation.




Ralf Moser | Eine Erkenntnislehre des Heiligen | Die Braut und die heilige Hochzeit | 2022
Ralf Moser | Eine Erkenntnislehre des Heiligen | Der Skorpion der Braut | 2022
Ralf Moser | Eine Erkenntnislehre des Heiligen | Der Opfertisch der Heiden| 2022
Ralf Moser | Eine Erkenntnislehre des Heiligen | Das blutende Herz des Bräutigams | 2022
Klaus Schmidt brachte die Idee ins Spiel, dass es sich bei Göbekli Tepe um den heiligen Berg Du-Ku der Sumerer handeln könnte. Nach sumerischem Glauben wurden Ackerbau, Viehzucht und Webkunst von diesem heiligen Berg zu den Menschen gebracht. Auf Du-Ku lebten die namenlosen Götter – die Ahnen der sumerischen Götter. Auch wenn diese Verbindung rein spekulativ ist, bleibt sie eine faszinierende Vorstellung.
Unabhängig davon zeigen die Grabanlagen der Megalithkultur, dass sich die Menschen jener Zeit mit ähnlichen Themen beschäftigten wie die Sumerer: dem Kreislauf des Lebens, seiner Prägung durch das Sonnenjahr, die Jahreszeiten und die Mondphasen. Der Mond symbolisierte diesen Kreislauf besonders eindrucksvoll – sein Werden vom Neumond zum Vollmond und sein Vergehen zurück zum Neumond spiegelten Geburt, Leben und Tod wider.
Das Bild „Die Braut und die heilige Hochzeit“ zeigt ein Großsteingrab im Wildeshausener Geest an der Straße der Megalithkultur. Es entstand um 3.500 v. Chr., in einer Zeit, als die neolithische Revolution die ersten bäuerlichen Kulturen nach Nordwestdeutschland brachte. Die Nordwest-Südost-Ausrichtung des Grabes legt eine Verbindung zur Sommersonnenwende nahe, da es auf den Sonnenaufgang zu Mittsommer ausgerichtet ist. Die Steinreihen deuten zudem auf die Extrempunkte der Monddeklination hin – ein Hinweis auf die Bedeutung von Himmelsbeobachtungen für die Menschen jener Zeit.
Auch bei den Sumerern spielte die Himmelsbeobachtung eine zentrale Rolle. In ihren Mythen verkörpert die Braut der heiligen Hochzeit Inanna – die erste Tochter des Mondes, Morgen- und Abendstern sowie Fruchtbarkeitsgöttin. Sie wurde zur Herrin über Himmel und Erde, Leben und Tod. Später wurde sie in Babylon als Ištar verehrt. In der heiligen Hochzeit verlieh sie den Königen von Uruk göttliche Legitimation und versprach durch ihre Herrschaft Fruchtbarkeit, Schutz und Wohlstand.
Im Mythos „Inanna bringt das Himmelshaus auf die Erde“ begegnet sie dem Skorpion des Himmels und schlägt ihm den Schwanz ab – ein Teil des sumerischen Schöpfungsmythos, der später auch die Genesis im Alten Testament beeinflusste. Am Ende des Mythos erkennt Anu, der Himmelsgott, Inanna als Oberste der Anunna an – des göttlichen Rates, bestehend aus allen Göttern, die von Anu abstammen. Der ideale Staat der Sumerer war durch diesen Götterrat geprägt – ähnlich wie Platons Idealstaat durch den Philosophenrat.
Im Mythos „Inanna und Enki“ gelingt es ihr, die Tafeln der Weisheit und des Schicksals aus Eridu nach Uruk zu bringen – ein Akt, der sie endgültig zur Herrscherin über die Götterwelt erhebt.
Auch das Opfern von Speisen und Getränken – vermutlich ein Brauch aus der neolithischen Revolution – wurde von den Sumerern übernommen und diente dem Erhalt der Fruchtbarkeit der Erde. Das blutende Herz des Bräutigams symbolisiert die Sterblichkeit der Könige von Uruk und ihren Wunsch nach Unsterblichkeit.
Der bekannteste König von Uruk ist Gilgamesch. Das ihm gewidmete Epos erzählt von seiner Freundschaft mit Enkidu, ihren gemeinsamen Heldentaten und seiner verzweifelten Suche nach Unsterblichkeit nach Enkidus Tod. Am Ende erkennt Gilgamesch, dass Unsterblichkeit nur den Göttern vorbehalten ist – Leben und Tod sind untrennbare Bestandteile der menschlichen Existenz.